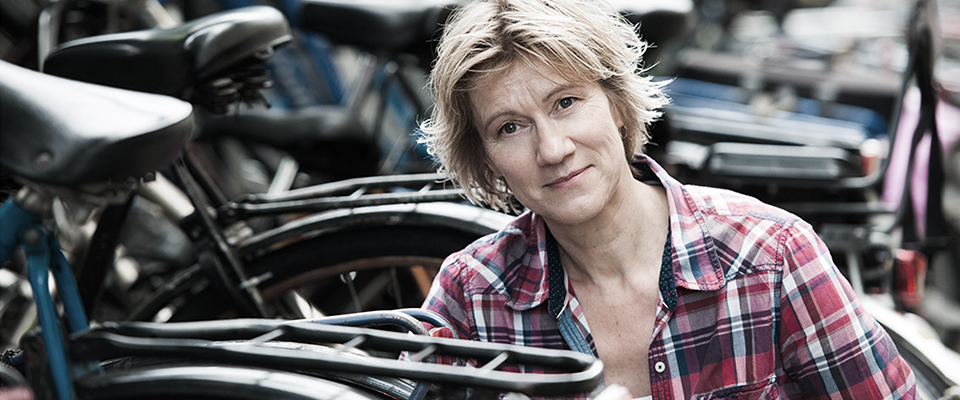
Erna Sassen im Gespräch mit ihrem Übersetzer Rolf Erdorf
Sich für sich selbst entscheiden
«Die Kinderbuchautorin Erna Sassen, einst Schwester Suzanne Lievegoed in der Fernsehserie ‹Medisch Centrum West›, ist witzig. Echt witzig, in ihren Kinderbüchern wie in ihren Bühnenauftritten. Aber manchmal macht ihre Fröhlichkeit einen etwas forcierten Eindruck – so als wolle sie einen großen Kummer geheim halten», schreibt die renommierte niederländische Tageszeitung NRC in ihrer Rezension des Romans «Dit is geen dagboek». Die deutsche Ausgabe, «Das hier ist kein Tagebuch», wurde gleich doppelt für den diesjährigen «Deutschen Jugendliteraturpreis» nominiert. Zwar wurde die Vorabend-Klinikserie «Medisch Centrum West» in Teilen auch in Deutschland ausgestrahlt, aber dennoch war Erna Sassen bis zum Erscheinen von «Das hier ist kein Tagebuch» im deutschsprachigen Raum ein eher unbeschriebenes Blatt – ganz im Gegensatz zu ihrer Heimat. Folgen wir ein wenig ihrem Weg von der Schauspielerin und Bühnenkünstlerin über die Autorin vergnüglicher Kinderbücher bis hin zu der Autorin von Young-Adult-Romanen, die, wie es die belgische Tageszeitung «De Morgen» ausdrückt, «ihre Stimme gefunden zu haben scheint».
Rolf Erdorf | In Deutschland quasi ohne Vorgeschichte und dann gleich ein so positives Echo auf Das hier ist kein Tagebuch. Was sagen Sie dazu, Erna?
Erna Sassen | Ich finde es großartig. Wahrscheinlich habe ich nicht alles mitbekommen, aber was ich gelesen habe, hat mich sehr gefreut. Und die beiden Nominierungen für den Deutschen Jugendliteraturpreis sind einfach überwältigend. Ich bin fast ausgeflippt in dem Restaurant, in dem meine Verlegerin mir das erzählte.
RE | Lassen Sie uns auf Ihre hier eher unbekannte Vorgeschichte zurückkommen: Wie war das damals als Suzanne Lievegoed in Medisch Centrum West?
ES | Das war eine Soap Ende der 1980er-Jahre, für heutige Begriffe sehr langsam und veraltet, aber recht heftig in den Geschichten. Eine Staffel wurde ja auch in Deutschland ausgestrahlt. Das war schon lustig, wenn man plötzlich perfekt Deutsch spricht, wenn auch mit einer fremden Stimme. Ich spielte eine Krankenschwester, die verschiedenste Formen sexueller Gewalt ertragen und überleben musste. Erst war sie ein Inzestopfer (der Vater landete zufällig als Patient in dem Krankenhaus, in dem sie arbeitete), in der zweiten Staffel wurde sie im Keller ihres Wohnhauses vergewaltigt, und in der dritten schlug sie den Vergewaltiger ihrer Freundin tot. Also eine Aufeinanderfolge unglaubwürdiger Ereignisse – zumindest unglaubwürdig in dieser Kombination und Häufung. Damals hatte ich gerade meine Theaterschule beendet und machte meine eigenen Vorstellungen: eine Kombination aus Schauspiel, Musik und Kabarett, das entsprach mir viel mehr. Weil ich zudem nicht zu sehr auf diese Krankenschwesternrolle festgelegt werden wollte, ließ ich mich nach drei Staffeln aus der Serie schreiben. Der Festlegung bin ich leider dennoch nicht entkommen.
Tja, und dann habe ich aufgehört, selbst abendfüllende Programme zu schreiben und diese zu spielen. Es wurde mir zu schwer. Ich war ja rundherum für alles verantwortlich, und das schaffte ich auf die Dauer nicht. Auch weil ich immer ziemlich autobiografisch schreibe. Wenn nur eine Person im Saal saß, die uninteressiert wirkte, dann kam ich mir gewissermaßen als Mensch gescheitert vor. Manchmal spiele ich noch in Vorstellungen, die andere geschrieben haben. Was ich am Schauspielen besonders vermisse, ist die Musik. Ich vermisse das Singen mit Leuten, die das gut können, und die Zusammenarbeit mit professionellen Musikern.
RE | Musik spielt ja auch für Bou in Das hier ist kein Tagebuch eine große Rolle. Das Zitat aus Pergolesis Stabat Mater hat auch mich sehr berührt: «me sentire vim doloris fac, ut tecum lugeam» – «lass mich die Stärke deiner Schmerzen spüren, damit ich mit dir trauern kann.»
ES | Ja, Musik ist nicht zuletzt auch Trost. Als Jugendliche in meinem Zimmer habe ich immer zur Gitarre gesungen. Niemand durfte mich hören; nur ganz selten mal meine Mutter.
RE | Für Bou reicht es nicht einmal dazu. Er kann sich mit knapper Not einmal eine CD seines Vaters anhören. Warum, glauben Sie, lieben Jugendliche das Buch, das ein so schweres Thema behandelt?
ES | Depressionen sind für Jugendliche nichts Unbekanntes, denn die Pubertät ist eine schwierige Zeit. Wenige werden zwar eine Mutter zu beklagen haben, die Suizid begangen hat, aber Depressionen kennen sicher viele. Indem ich Bous Schicksal so verstärke, können Jugendliche sich erkennen und dennoch sagen: «So schlimm ist es bei mir nicht.» Auch eine Form von Trost …
RE | Auch in Ihrem neuen Roman, Komm mir nicht zu nah, ist die Protagonistin jemand, der es nicht leichtfällt zu leben. Eine junge Schauspielerin diesmal, die schlecht mit sich umgeht und auch umgehen lässt. Sie leidet an schweren Essstörungen und lebt auch ihre Sexualität eher selbstzerstörerisch aus. Können Sie verstehen, dass das manche Leute erschreckt?
ES | Anfangs wollte ich hauptsächlich über dieses Essproblem schreiben, das war mir das Wichtigste. Ich weiß, wie schlimm Mädchen damit zu kämpfen haben, und auch, dass viele Eltern überhaupt nicht ahnen, wie weit das geht. Also war es meine Absicht, das möglichst explizit zu schildern. Beim Sex ist es ähnlich.
RE | Beides hängt ja mit einem problematischen Selbstbild zusammen: Wie sehe ich mich selbst, was bin ich wert, was lasse ich mit mir tun? Reva sucht sich immer wieder zweifelhafte Sexualpartner, lädt Männer geradezu dazu ein, sie zu benutzen. Kann man da noch von Tätern sprechen? Wobei es dem Theaterdozenten, in dessen Bann sie gerät, weniger um Sex geht, sondern eher um Macht.
ES | Ich hoffe, ich habe das differenziert genug geschrieben. Es gibt einen Täter, aber Reva sagt auch nicht umsonst: «Ich habe es selbst gewollt.» Das ist durchaus autobiografisch; ich bin jemand gewesen, die Grenzüberschreitungen zuließ, was mir auch vorzuwerfen ist, oder ich habe es irgendwie nicht gelernt – da ist schon sehr früh etwas schiefgegangen. Mein Leben lang habe ich die Nähe zu Leuten gesucht – auch Frauen übrigens –, die meine Grenzen missachtet haben und bei denen ich das immer wieder zuließ. Freundschaften, in die ich so viel Energie gesteckt habe, dass ich später dachte: Wie ist es möglich, dass ich das immer wieder getan und mich dabei so verausgabt habe?
RE | In Komm mir nicht zu nah beschreiben Sie recht autobiografisch Ihre familiäre Situation als Kind mit einem depressiven Vater, einer aufopferungsvollen Mutter und mehreren Geschwistern. Da gibt es ja manchmal gewisse «Aufgabenteilungen». Waren Sie eher die Vermittelnde?
ES | Ja – und die Frage ist: Inwieweit nimmt man diese Rolle an oder lässt sie sich aufdrängen? Ich glaube, es hat wirklich etwas mit der Stellung in der Familie zu tun. Ich war eins der beiden mittleren Kinder, bin ohnehin empfänglich für die Stimmungen anderer und will es immer allen recht machen – auch, um Liebe zu bekommen. Doch mein Vater hatte davon nicht so viel zu verteilen … Im Buch steht ein Satz, eine Frage, die Revas Schwester Marjolijn ihr stellt: «Wird das jetzt dein Lebensziel, Menschen, die dich nicht lieben, dazu zu bewegen, es doch zu tun?»
RE | Und in einem anderen Satz heißt es: «Wenn jemand dich nicht liebt …»
ES | … «dann bedeutet das nicht, dass du es nicht wert bist, geliebt zu werden.» Diese Erkenntnis ist überlebensnotwenig!
RE | Eine positive Kraft in Ihren beiden Romanen ist der geschwisterliche bzw. familiäre Zusammenhalt: Bous Tante Marjan und seine kleine Schwester Fussel in Das hier ist kein Tagebuch, und Revas Schwester Marjolijn in Komm mir nicht zu nah.
ES | Für die kleine Fussel hat meine Tochter Modell gestanden und für Bous Tante und Revas Schwester tatsächlich meine Schwester. Uns Geschwister haben die familiären Schwierigkeiten zusammengeschweißt, während meine Mutter zwischen Mann und Kindern hin- und hergerissen war – oder wurde. Mein Vater war oft eifersüchtig auf die Aufmerksamkeit, die wir von ihr bekamen. Meine Mutter war eine Art Personifizierung des Guten, fast eine Muttergottes – fanden alle. Ich glaube, Mutter fand das auch selbst (lacht) – und Vater war der Egoist. So war das aufgeteilt. Das war nicht gut, denn es macht, dass man als Kind die Aspekte verurteilt und jene nicht leben kann, in denen man seinem Vater ähnelt. Es fiel mir unheimlich schwer, im Nachhinein zu denken: Sich für sich selbst zu entscheiden ist nicht nur falsch. Und das Beispiel unserer Mutter mussten meine Schwester und ich auch teilweise abschütteln: Also nicht immer zuerst schauen, wie es den anderen geht, sondern bei sich selbst bleiben. Auch anderen ist nicht immer damit gedient, wenn man sich selbst derart übergeht. Das hat sich in meinem Leben gezeigt.
RE | Ist heute davon noch etwas spürbar?
ES | Daran arbeitet man sein ganzes Leben. Auch an der Wut, die in einem steckt. Geboren wurde ich in Beverwijk, das ist nah an der Nordsee, und mit neun bin ich in ein Neubaugebiet von IJmuiden gezogen, das war direkt an den Dünen und das fand ich großartig. Es gab da einen Baum, in dem habe ich immer gesessen, um nachzudenken – ich war sehr nachdenklich früher –, bis ich irgendwann begriff, es war wohl in der Pubertät, dass ich mich abends vielleicht nicht mehr so in einen Baum setzen sollte: zu gefährlich. Da bin ich unheimlich böse geworden, dass ich diese Angst bekam. Ich war unheimlich böse auf die ganze Welt.
RE | Eine Energie, die Sie inzwischen sehr gewinnbringend nutzen, wie Ihre beiden Bücher beweisen, die ich übersetzen durfte. Und was macht das Theater?
ES | Das geht anders und aufregend weiter. Das hier ist kein Tagebuch kommt im März 2017 im Hamburger Schauspielhaus auf die Bühne! Das schauen wir uns doch gemeinsam an, ja? Und Sie sind immer herzlich eingeladen zu einem Spaziergang in den Haarlemer Dünen. Hier lebe ich mit meinem Mann Aike – er ist Theaterregisseur, ich habe ihn mit 30 Jahren kennengelernt, als ich einen Regisseur für mein Soloprogramm suchte –, meinem Sohn Mats und meiner Tochter Micky. Und wenn wir in den Dünen spazieren gehen, dann erzähle ich Ihnen vielleicht auch von meinem dritten Roman, den ich gerade schreibe …














