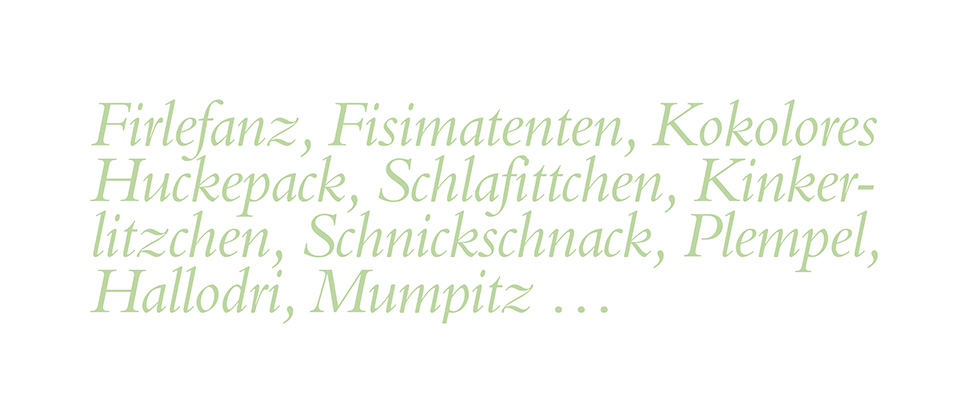
Christa Ludwig
Vom Klang der Kellertür
Bei einer Lesung in einer internationalen Schule stellte mir ein Junge eine ungewöhnliche Frage: «Schreiben Sie nur deutsch oder auch in anderen Sprachen?»
Während meines Studiums schrieb ich tatsächlich nicht deutsch, sondern englisch. Ich hatte Verwandte in England, war häufig dort und mit der Sprache vertraut. Und ich graulte mich vor der deutschen Sprache. Ich fand sie klumpig, spröde, schwer in einen Rhythmus zu bringen und für Lyrik geradezu unbrauchbar. Wenn etwas Neues erfunden und ein Wort gebraucht wird, das keinen Urahn im klangvolleren Altgotischen hat, dann benennen die Deutschen es mit einem unmelodischen Wortbrocken: Reißverschluss – die Engländer sagen zip. Sollte es in England so etwas geben wie einen Eikappensollbruchstellenverursacher, dann nennt man diesen überflüssigen Gegenstand dort wahrscheinlich egg grab oder so ähnlich.
J. R. R. Tolkien (Der Herr der Ringe) hat einmal gesagt: «Es gibt Wörter, die sind einfach schön, egal, was sie bedeuten, sie sind schön, zum Beispiel cellar door.» Und ich ärgerte mich, dass ich deutschsprachig aufwachsen musste und beneidete glühend alle Engländer, die einen Klang wie cellar door verschwenden konnten an so etwas Banales wie Kellertür. Ich machte mich auf die Suche nach ähnlich Klangvollem im Haus: ich lehnte mich an die Fensterbank (oh, window sill), schlurfte über den Fußboden (ach, floor), stolperte die Treppenstufen hinunter (hach, steps), draußen spielten ein paar Kinder Tischtennis, und wären sie englisch und hätten ping-pong gespielt – wie viel lustiger wären die Bälle geflogen im KlickKlackTakt.
Mein Erzfeind der deutschen Sprache war die Wendung etwas auswendig lernen. Was für ein Unsinn! Wenn es wenigstens inwendig lernen hieße! Aber auch das wäre keine Konkurrenz zu learn by heart.
Die deutschsprachigen Dichter, dachte ich, gehen mit Handicap ins Rennen um den Lorbeerkranz. Sie haben keine Chance. Warum nur gab ich mich stunden-tagelang mit diesen Losern ab? Warum saß ich bei jeder möglichen und unmöglichen Gelegenheit auf Stühlen, Bänken, Wiesen, in Bussen und in Straßenbahnen mit Sammlungen deutscher Gedichte und verpasste es, ein- oder auszusteigen?
Weil man Sehnsucht kaum eindringlicher beschreiben kann als mit Folg ich der Vögel wundervollen Flügen (Georg Trakl), Entsetzen nicht bedrohlicher beschwören kann als mit Schwarze Milch der Frühe (Paul Celan), einen alten Tibetteppich nicht bunter knüpfen kann als mit Maschentausendabertausendweit (Else Lasker-Schüler).
Womit bewiesen ist, dass dieselbe sprachliche Eigenart, die ein Wort wie Eikappensollbruchstellenverursacher zu verantworten hat, durchaus lyrikrelevant ist.
Von da an schrieb ich deutsch – und aus allen Ecken, Fugen und Ritzen stürmten Wörter herbei, die den Vergleich mit cellar door nicht scheuen mussten: Firlefanz, Fisimatenten, Schlafittchen, Mumpitz, Kokolores, Kinkerlitzchen, Plempel, Schnickschnack, Huckepack, Hallodri … Das Wort erinnern versöhnte mich mit auswendig lernen. Die Weisheit der Enttäuschung erhellte mir die damit beschriebene Lebenserfahrung, verwandelte sie diese doch in die positive Erkenntnis, dass eine Täuschung aufgehoben wurde. Mein Lieblingswort der deutschen Sprache aber wurde saumselig, ein Klang und ein Zustand von purem Genuss.
Und nun habe ich ein neues Lieblingswort: redseelig …