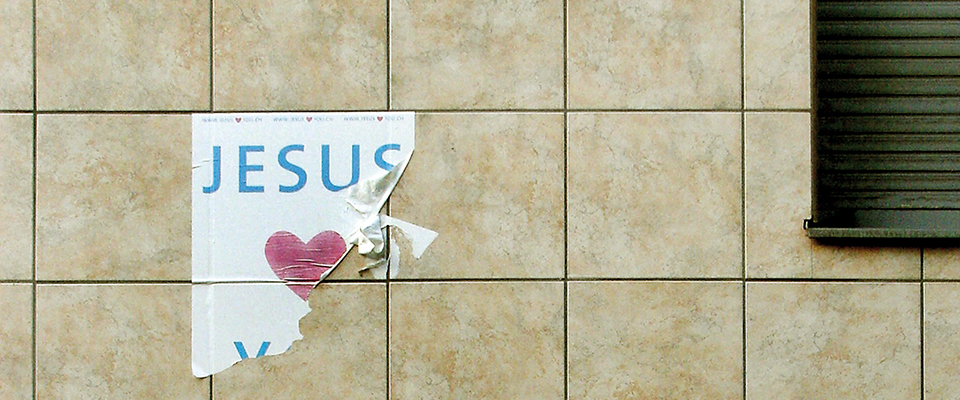
Rolf Bauerdick
Zweifel – Über die nicht nur dunkle Nachtseite des Glaubens
Während alle Welt von ihr zu wissen glaubte, sie stehe im Licht, irrte Agnes Bojaxhiu durch die Finsternis. Menschen schauten zu ihr auf, zu einem Vorbild der Mitmenschlichkeit, zu einer Gottesdienerin, selbstlos in ihrer Hingabe, standhaft im Glauben und von keinem Zweifel geplagt. Doch eine Kluft tat sich auf. Selten war der Graben zwischen der Fremdwahrnehmung einer Person und ihrer Selbsteinschätzung tiefer als im Leben der Frau, die 1979 den Friedensnobelpreis erhielt und als Mutter Teresa zur Ikone irdischer Heiligkeit wurde. Dann erschienen 2007, zehn Jahre nach ihrem Tod, ihre umfangreichen Tagebuchnotizen und persönlichen Briefe. Der Einblick in das Seelenleben der Ordensfrau verstört noch immer: «Der Platz Gottes in meiner Seele ist leer. Da ist kein Himmel in mir.»
Die Öffentlichkeit verklärte die Patronin der Sterbenden und Leprösen als Engel der Armen. Währenddessen quälte sich Mutter Teresa in Kalkutta durch die Nacht des Glaubenszweifels. Und das jahrzehntelang. «Es herrscht eine solche Dunkelheit, dass ich wirklich nichts sehen kann, weder mit meinem Geist noch mit meinem Verstand», schrieb sie an eine Vertraute. Ein Schock für alle, die nur das Bild der dauerlächelnden Missionarin kannten. Sie beklagte «eine furchtbare Leere» und bekannte: «In meinem Innern ist es eiskalt.» Wer bis dato an Mutter Teresas Heiligkeit gezweifelt hatte, mit dem Vorwurf, sie idealisiere die Armut und neige zur Frömmelei, sah seine Zweifel bestätigt. Ihren Verehrern hingegen schienen alle Bedenken an Teresas Seligkeit ausgeräumt, vermochte doch nur eine wahrhaft Heilige derartig zermürbende innere Kämpfe zu überstehen.
Entgegen landläufiger Ansicht ist das abgründige Erleben der Gottesferne keine Erfahrung von erklärten Atheisten und Agnostikern, eher von Gläubigen, die als ausgesprochen fromm gelten. Das Mädchen Bernadette Soubirous etwa, dem im Jahre 1858 an einer Quelle am Fuße der Pyrenäen achtzehnmal eine «schöne weiße Dame» erschien, woraufhin Lourdes zu einem der bedeutendsten Marienwallfahrtsorte aufstieg, seufzte am Ende ihres Lebens: «Mein Gott, wenn ich mich getäuscht hätte.» Die Seherin zweifelte damit an sich und ihrer Bestimmung, nicht aber an Gott. Ähnlich auch der mittelalterliche Mystiker Johannes vom Kreuz. In seinem spirituellen Gedichtswerk Die dunkle Nacht der Seele beschreibt er keineswegs Depression oder Melancholie. Er ersehnt die Erfahrung Gottes, aber er zweifelt und verzweifelt nicht an ihm.
Doch die Zeiten ändern sich. Vor über hundert Jahren schon stellte der Schriftsteller und Erfinder der Pater-Braun-Figur Gilbert Keith Chesterton eine Verschiebung vom zweifelnden Subjekt zum bezweifelten Objekt fest. In seinem Buch Orthodoxie schrieb der lebenskluge Brite: «Der Mensch sollte an sich selbst zweifeln, aber doch nicht an der Wahrheit; das hat sich genau ins Gegenteil verkehrt. Heute ist das, worauf der Mensch beharrt, genau der Teil, auf dem er nicht beharren sollte – er selbst.
Und das, woran er zweifelt, ist genau der Teil, an dem er nicht zweifeln dürfte – die Vernunft Gottes.»
Der Zweifel ist für Chesterton keine Bremse, die Menschen hindert, in ihrer Entwicklung voranzukommen, sondern der Motor, der uns antreibt, nicht selbstgenügsam auf der Stelle zu treten. In diversen Lebenssituationen freilich sind Zweifel eher unangebracht. Ein Chirurg, der seinen Händen nicht vertraut, sollte nicht zum Skalpell greifen. Und der Elfmeterschütze, der im Moment des Anlaufs an seiner Treffsicherheit zweifelt, ist ein sicherer Kandidat für das, was man im Fußball einen Ball versemmeln nennt.
Egomanen haben den Selbstzweifel ausgeschaltet. Das macht Begegnungen mit ihnen so unerquicklich. Andere wiederum dürfen und müssen allein ihres Berufes wegen nicht an sich zweifeln. Dem Künstler sieht man den Zweifel nach, dem Politiker nicht. Wer an seinen Entscheidungen zweifelt, gilt als Zauderer, als Bedenkenträger, unfähig, Verantwortung zu tragen. Ein Politiker, der einen Irrtum zugibt, ist in der Regel erledigt. Wer fehlgeht, hat seinen Hut zu nehmen. In Zeiten, in denen Fehler nicht mehr menschlich sind, sondern den Anlass zu öffentlicher Häme und Demontage liefern, stirbt der Zweifel. Für seine Abschaffung steht der Shitstorm, der alles hinwegfegt, bloß nicht die Bedenken an der Wahrheit der eigenen Meinung.
Zweifler wie der klagende Hiob im Alten Testament oder der ungläubige Thomas im Neuen sind heute unpopuläre Figuren. Doch die jüdisch-christliche Kultur des Abendlandes beruht selbst auf einem Zweifel, wohl dem größten der menschlichen Religionsgeschichte, als Jesus in der völligen Einsamkeit am Kreuz in die Verzweifelung stürzt. «Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen!» In diesem Moment der Gott-verlassenheit, so der Künstler Joseph Beuys, stehe für einen Augenblick alles infrage, und die jesuanische Botschaft scheine nicht mehr real zu sein. «Das, wofür er selbst steht, wofür Jesus in seinem Leben stand: Ich werde euch frei machen.»
Das zweifelsfreie und widerspruchsfreie Leben ist ein Leben ohne Fragen. Es endet in der Geistlosigkeit. Ohne Zweifel keine Wahrheit. Nur Banalitäten werden nicht bezweifelt. Von daher ist die Frage «Zweifeln oder glauben?» eine falsche Alternative. Nicht unerheblich ist die richtige Balance. «Der Mensch muss gerade so viel an sich glauben, dass er Abenteuer erlebt», sagt Chesterton, «und gerade so viel an sich zweifeln, dass er sie genießt.»
Zu erwähnen ist noch eine Denkwürdigkeit, die bei Mutter Teresa auffällt. Ihre ersten Glaubenszweifel keimten auf, just als sich für sie ein Traum erfüllte. 1928 war sie als Achtzehnjährige den Loretoschwestern beigetreten, war nach Indien gegangen und hatte als Lehrerin an einer Klosterschule unterrichtet. In ihrem brennenden Wunsch, in ihrer Liebe zu Jesus ganz für die Armen da zu sein, ersehnte sie einen eigenen Orden. Jahrelang kämpfte sie dafür im Vatikan, äußerst hartnäckig. 1950 kam Papst Pius XII. ihrem Wunsch nach. Teresa gründete ihre Kongregation der Missionaries of Charity und stand plötzlich im Licht. Ihr Lebenswerk blühte und wuchs, sie wurde berühmt, war ständig weltweit unterwegs in ihrer Mission der Nächstenliebe. Sie wurde von den Mächtigen hofiert und mit Ehrungen überhäuft.
Doch vieles spricht dafür, dass mit ihrem äußeren Aufstieg ein innerer Abstieg einherging. Erst als ihre Wünsche ihre Erfüllung fanden, wurden die Fundamente ihres Glaubens brüchig, die Zweifel übermächtig. Dass dies ein bloßer Zufall war, sollte durchaus bezweifelt werden.