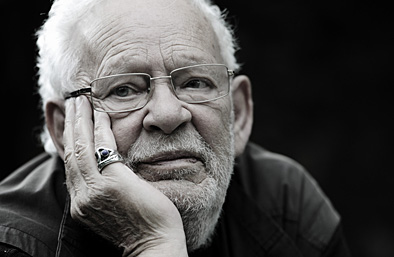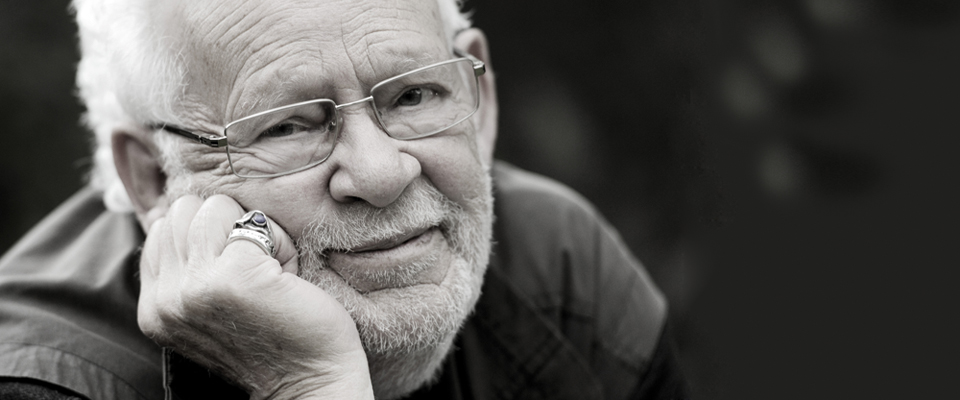
Jacques Berndorf im Gespräch mit Ralf Lilienthal
Obsession von Anfang an
Er ist Deutschlands erfolgreichster Krimiautor und seine «Bindestrich-Eifelkrimis» («Eifel-Blues«, «Eifel-Gold«, «Eifel-Filz» ...) sind gewissermaßen die «Leuchttürme» des inzwischen alle deutschen Landschaften umfassenden Genres: Michael Preute, alias Jacques Berndorf, der Schöpfer des Journalisten und Mordaufklärers Siggi Baumeister.
Ein Besuch im kleinen Vulkaneifel-Kaff Deis-Brück erfüllt auf angenehme Weise sämtliche Vorerwartungen des mit gut 12 Berndorf-Krimi-Lektüre-Erfahrungen angereisten Interviewers. Wir sitzen auf der Terrasse. Satchmo, der alte Kater, schnurrt dazu. Baumeisters obligatorische Pfeife qualmt. Vor allem aber die von einigen Hörbüchern angenehm vertraute Stimme – mindestens so rauh, tief und variationsreich wie die von Harry Rowohlt – trägt den Zuhörer weit über den Moment hinaus in eine eigene, reiche Welt.
Ralf Lilienthal | Michael Preute, Jacques Berndorf und ihr Krimi-Alter-Ego Siggi Baumeister scheinen miteinander zu verschmelzen. Doch irgendwo in der fernen Vergangenheit hatten die drei mutmaßlich eine gemeinsame Kindheit. Verkürzt auf ein paar Stichworte: wie war das damals?
Jacques Berndorf | Vieles in den ersten Jahren blieb erinnerungsloser Alltag. Die Kriegs- und Nachkriegsjahre waren dann von Abenteuerlust geprägt. Natürlich gab es auch harte Brocken zu kauen – die Kinderlandverschickung, die Bombenangriffe –, aber das war aushaltbar. Angst hat mir niemand beigebracht. Wovor denn auch? Schule, das war keine Frage von Leistung, sondern von «ich mag» oder «ich mag nicht», von guten oder schlechten Lehrern – was das betrifft, hatte ich alles in allem ziemliches Glück.
RL | Als es galt, eine berufliche Entscheidung zu treffen, war da der Weg vom Abiturienten zum Journalisten eine Einbahnstraße?
JB | Geschrieben habe ich schon früh – vor allem Shortstorys im Stil Hemingways. Aber eigentlich wollte ich Kinderarzt werden. Doch mein Vater war gegen das in seinen Augen «unsinnig lange» Studium. Also habe ich kurzerhand hingeschmissen und bin beim Duisburger Generalanzeiger in die Lehre gegangen. Mit allem, was dazugehört: Seite 1, 2 und 3 – die große Welt und der Taubenzüchterverein. Jede Menge freiwilliger Nachtschichten. Ich habe sogar «Mettage» gelernt, also das handfeste Seitenlayout, ganz ohne Computer. Und weil dort ohne Suff gar nichts ging, habe ich das Saufen gleich mitgelernt. Die Schreiberei selber flog mir zu – mir musste niemand erzählen, wie man einen Artikel über was auch immer zusammenbastelt.
RL | Weshalb Sie schließlich auch in der ersten Liga der Zeitschriften landeten.
JB | Zwischen dem Generalanzeiger und der freien Arbeit für die großen Magazine lagen noch einige Redaktions-Zwischenstationen, wie etwa bei der NRZ (Neue Ruhr / Neue Rhein Zeitung), der Rheinischen Post oder dem Düsseldorfer Büro des Sterns. Und zuletzt bei der Quick: Nach einer unverzeihlichen Illoyalität meines Chefredakteurs während einer Recherche in der Zeit des Prager Frühlings, wollte ich raus und auf eigene Rechnung schreiben. Ich habe dann für Ferenczys Presseagentur gearbeitet, außerdem war ich im Pool von dpa, Ap, AFP usw.
RL | Das war dann auch die Zeit des Krisenreporters Preute, der immer wieder dorthin ging, wo es richtig weh tun konnte.
JB | Oh ja, das waren wilde Jahre – Vietnam, Israel, Südafrika, die Kokainkriege. Weil mein eigenes Leben damals nur noch mit immer mehr Alkohol lief, war ich irrsinnigerweise als völlig unerschrockener Mensch bekannt – nach dem Motto: «Ach, da schicken wir den Preute hin, der hat eh’ keine Nerven.» Nein! Der war immer besoffen, so simpel war das!
RL | Waren Sie zu dieser Zeit verheiratet?
JB | Natürlich. Schon zum zweiten Mal. Ich habe ja viermal geheiratet und kann mich an dieser Stelle nicht ganz ernst nehmen. Das war meine Art, den guten Bürgern zu sagen, dass ich es auch kann, dass ich auch dazugehöre. Aber eigentlich ging es mir nur gut, wenn ich mit meiner Schreibmaschine alleine gelassen wurde. Spannend wurde es erst, als ich begriff, dass man so nicht leben kann, dass der Alkohol fürchterliche soziale Fehlleistungen verursacht und am Ende alles kaputt macht. Mit Vierzig habe ich dann damit aufgehört, und zwar abrupt. Sechs Monate klinischer Entzug und Therapie haben mein Leben gerettet, das ich noch kurz zuvor selber hatte auslöschen wollen.
RL | Wie muss man sich die erste Zeit danach vorstellen?
JB | Als ein allmähliches Vorwärtskämpfen. Alleine, nur auf mich gestellt. Ich habe in München zuerst Autos gewaschen, dann auch wieder geschrieben. Bis ich schließlich Ende ’84 – inzwischen erprobt nüchtern – in der Eifel gelandet bin, ohne Familie und mit schrecklichen Schuldgefühlen. Es war, als wäre ich nach Hause gekommen. Die Eifel war vom ersten Moment an das Gegenprogramm zu allem, was vorher war. Auf endlosen Spaziergängen entdeckte ich die Landschaft, die Stille – manchmal habe ich die halbe Nacht einfach nur dagesessen und Wald geatmet. Gleichzeitig wurde der Wunsch, die Welt noch einmal neu zu erobern, immer größer. Nach etlichen journalistischen Arbeiten zwischen Bonn und Brüssel war ich eines Tages plötzlich sechs Wochen lang ohne Aufträge. In dieser Zeit entstand Eifel-Blues. Obwohl ich mir sicher war, dass meine Art zu schreiben Leser finden könnte, dachte ich nicht daran, in den riesigen Krimi-Markt einzusteigen. Mein Nachbar Werner, ein Kinderarzt aus Köln, hat dann den Roman gelesen und ihn Rutger Boos gezeigt, der ihn gleich veröffentlichen wollte.
RL | Und der später die Jacques-Berndorf-Bücher ins Zentrum
seines neu gegründeten Verlags grafit gestellt hat – mit millionenfachem Erfolg!
JB | Vorher ging es noch eine Weile hin und her, weil abwechselnd er oder ich nicht wollte. Rutger Boos war für mich ein guter Verleger, einer, der unter anderem die Gabe hatte, in den zwei Monaten vor Weihnachten mal eben 80.000 Bücher zu verkaufen.
RL | Trotzdem haben Sie vor einigen Jahren den Verlag gewechselt ...
JB | Man kann sich das wie bei einer alten Ehe vorstellen. Irgendwann war der Dampf raus. Übrig blieben zwei alte Dickschädel, von denen jeder Recht behalten wollte. Und weil in dieser Zeit Ralf Kramp, selber Krimi-Autor, den KBV Verlag übernahm, nach Hillesheim zog und sein Kriminalhaus gründete, bin ich schließlich zu ihm gewechselt.
RL | Sie waren und sind ungeheuer produktiv. Dahinter leuchtet ein Fleiß auf, wie man ihn etwa von Georges Simenon kennt. Doch während dessen psychologisierende Maigret-Krimis im stets gleichen Milieu spielen, führen Sie Ihre Leser von Buch zu Buch durch immer andere, gründlich und detailreich recherchierte Bezirke – dafür ist offensichtlich der Journalist verantwortlich!?
JB | Mein Schreiben war von Anfang an Obsession. Und egal ob Roman oder Artikel, ich liefere so ab, wie jeder gründliche Journalist abliefert. Geniale Schreibe? Quatsch, das ist Arbeiterei. Wenn Sie irgendeinen meiner Schmöker lesen, können Sie sicher sein, dass er nach allen Seiten hin- und hergewendet ist und «stimmt». Ich will, dass sich der Leser sagt: Das könnte ja wirklich so sein! Was übrigens auch daran liegt, dass ich jedes Mal mit Leuten rede, die sich wirklich auskennen: Staatsanwälte, Kommissare, Psychiater – Freunde, denen ich die vertracktesten Geschichten vorlegen kann.
RL | Während die harten Fakten Ihren Eifel-Krimis die nötige Authentizität verleihen, ist es aber wohl die besondere, dem Leser so schnell vertraut werdende Konstellation der Figuren um Baumeister, Emma und Rodenstock, die den Sucht-Faktor dieser Reihe ausmacht!?
JB | Viele, vor allem Frauen, lesen meine Bücher nicht nur der Krimi-Storys wegen, sondern weil darin eine Gruppe von Leuten außerhalb der Norm lebt. Menschen, die gelassen sind. Die sagen: Sei so, wie du bist und nicht anders! Und die mit Demut an das Leben der anderen herangehen, in einer Art, die uns allen gut tun würde.
RL | Gibt es Rodenstock und Emma eigentlich im richtigen Leben?
JB | Na sicher. Rodenstock ist eine Hommage an den Münchener Kriminalisten Hermann Schmidt, genannt «Mord-Schmidt», von dem ich unglaublich viel gelernt habe. Der rief mich nachts an: «Michael, komm mal raus in die Pathologie, wir haben eine Isarleiche, die musst du dir angucken!» Und Emma ... das war im Yom-Kippur-Krieg. Ich war nahe der Front in ein vornehmes Bürgerhaus eingeladen. Ein Familienfest, vierzig Leute von überall her. Plötzlich gerieten wir unter Beschuss, die Decken kamen herunter, alles rannte in den Keller. Außer mir war nur noch eine Frau oben geblieben. Den Telefonhörer am Ohr plauderte sie ungerührt mit ihrer Schwester in London: «Das ist ja toll, dass wir uns mal wieder in Ruhe austauschen können. Ich weiß gar nicht, wo die Männer sind, ich glaube die sind eine rauchen ...» So was kann nur eine Frau bringen! Daran habe ich mich erinnert und sie zum Maschinengewehr der weiblichen Emanzipation und Intuition gemacht.
RL | Der Schriftsteller, zumal wenn er wie Sie Serien-Täter ist, genießt ein unschätzbares Privileg:?Er kann «Spiel-Partner» in die Welt setzen und sich an ihnen weiterentwickeln. Und er kann, wie Münchhausen, der sich am eigenen Zopf aus dem Sumpf zieht, seinem Roman-Ich ein Drehbuch in die Zukunft hinein schreiben, an dem er sich dann auch im realen Leben orientiert.
JB | Ohne Zweifel. Ich habe Baumeister 48 Jahre alt sein lassen und gab ihm auch sonst stückchenweise meine Geschichte. Gleichzeitig war er mein Einbruch in ein neues Leben. Allerdings hätte ich nichts verschnellern können. Die Geschichte und das Leben – beides musste reifen. Auch die Widersprüche und Brüche meines Lebens konnte ich auf diesem Weg nicht reparieren. Hier der Säufer, da der Gutmensch der Eifel – das bleibt unverbunden. Trotzdem muss man aufhören, mit Schuldgefühlen ins Bett zu gehen und mit Schuldgefühlen aufzuwachen. Such is life!
RL | Zufriedene Resignation – nicht das schlechteste Programm für die Zukunft.
JB | Für die Zukunft habe ich kein Programm! Ich bin froh, dass diese Landschaft hier so ist, wie sie ist. Mit diesen Menschen. Und ich hoffe, ich bin noch eine Zeit lang dabei. Das Leben ist schön, ruhig und wie immer voller Arbeit. Wenn der «Alte Mann« da oben mitmacht, kann ich noch ein Weilchen bleiben. Wenn nicht – ist auch egal, dann will ich in Würde gehen. Schluss. Aus. Nicht so schlimm!